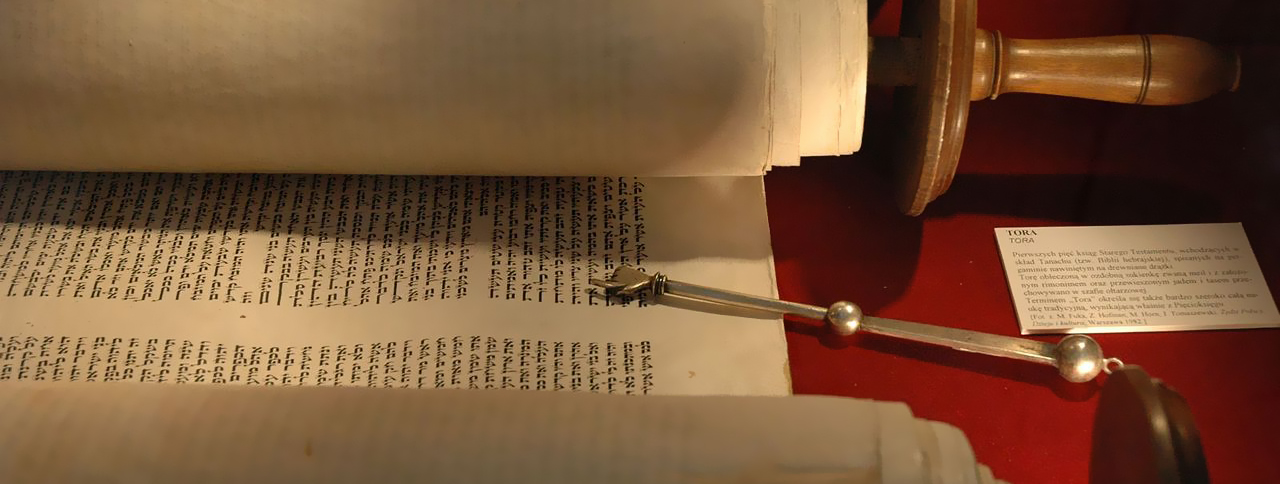
Jan Wagner: Europas trübe Wasser lyrikkritik.de. Natürlich sind die hier angedeuteten Frontstellungen längst nicht mehr so ausgeprägt, ich spitze bewusst zu. In dem 2010 in der Edition Thanhäuser publizierten Essayband Baltische Adria, verfasst von Ališanka und dem slowenischen Autor Ales Debeljak, wird die Biografie selbst zum Thema. Zeigen ihn am Wannsee in Zwiesprache mit Kleist und den Dämonen der Nazi-Zeit („senkrechter rauch aus dem schornstein / senkrechte steine / hölzerne charly-kreuze und wannsee-kalmus / der see zählt die fische / vor der schliessung im winter / … / auch ich mache knocheninventur?“) oder in Wiepersdorf vor „leeren wachtürmen“ und „stacheldrahtzäunen zum schutz von seltenen arischen gewächsen“. Der Terminus Postmodernismus, wiewohl inflationär verwendet, um mittlerweise alles und jedes auf diesen Nenner zu bringen, hier ist er nicht zu umgehen. Vielleicht einfach deshalb, weil das, was er einbringt, sich, ähnlich wie auch das Werk des Exilpoeten Tomas Venclova, nicht der eher liedhaften litauischen Tradition zuordnen lässt, die hier noch immer einflussreich ist. Erforderliche Felder sind mit * markiert. Eugenijus Ališankas Gedichte kommen so behende, so leichtfüßig daher, daß man meinen könnte, sie seien vielleicht allzu unbekümmert und möglicherweise von leichtherzigem oder gar leichtfertigem Charakter. Finde Gedichte! In Litauen hat er sich damit nicht nur Freunde gemacht, wie sein Übersetzer Klaus Berthel im Nachwort berichtet. ): Budapester Szenen, Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden, Christa Melchinger: Zu Claude Vigées Gedicht „Winterweiden“, Harald Hartung: Zu Christoph Meckels Gedicht „Es war der Atem im Schnee“, Paul Michael Lützeler: Zu Hermann Brochs Gedicht „Diejenigen, die im kalten Schweiß“, #tuerlesung 0.08 – Richard Pietraß: Hundewiese, Klausur & Amok, Felix Philipp Ingold: Nachruf Pierre Chappuis, Erstes Wiener Heimorgelorchester und Ror Wolf: Das nordamerikanische Herumliegen, BRODSKY …FERNGESPRÄCHE verfilmt in 9 Kapiteln | Kapitel 1: San Pietro, Anderthalb Zimmer in Leningrad: Ein Museum für Joseph Brodsky, Rainer Malkowski – Frühes Notat | Pega Mund : driftout, Hans Magnus Enzensbergers Gedicht „Minimalprogramm“, Eva Hesse: Zu Ezra Pounds Gedicht „Cantos VII“. Texte: Bosse: Kamikazeherz (2005), Eugenijus Ališanka: identitätskrise (2005), Friederike Mayröcker: Der Aufruf (1974), Julia Engelmann: One Day (2013), Christoph W. Bauer: fremd bin ich eingezogen unter meine haut (2009), Robert Gernhardt: Noch einmal: Mein Körper (1987), Annette von Droste-Hülshoff: Das Spiegelbild (1844) Wie Zbigniew Herbert, den Ališanka ins Litauische übersetzt hat und dem er als Autor viel verdankt, hält sein lyrisches, Rollen spielendes Subjekt Zwiesprache mit Dichtern und Philosophen: Epikur und Empedokles, Dante und Proust, Miłosz und Barthes. Auch der noch wenig übersetzte Aidas Marcenas, der im Oktober dank eines Stipendiums des Bank Austria Literaris seine Poesie in Wien vorstellen wird, liebt die alten strengen Formen, allen voran das Sonett. Eingespannt in das Räderwerk namens „historischer Prozess“, bewegen sich seine Protagonisten wie Hamster in einem Laufrad. Der litauische Lyriker Eugenijus Ališanka lebt in Vilnius. Es war kein gewöhnlicher Zug, sondern eine Art fahrende Großmetapher: Mit diesem „Literaturexpreß“ reisten über hundert Schriftsteller aus 43 europäischen Ländern, die die grenzüberschreitende Kraft der Literatur verkörperten. Daß Europa für Ališanka vor allem eine tabula rasa ist, auf der die Reiche und Mächte mit Blut die Spuren ihrer Herrschaft eingezeichnet haben, wird aus seiner Biographie verständlich. Er schwankt zwischen Ernst und Farce, zwischen Absicht und Versehen: ich fühle mich heute wie ein kater in der regenrinne ungewiss wie ich hineinglitt wohin es mich verschlägt. In Ališankas zweitem Lyrikband Peleno miestas (Stadt aus Asche), 1995, nimmt das Metaphysische die konkrete Gestalt einer toten Stadt an, so auch des vorzeitlichen, leblosen Vilnius, von dem es heißt: unbekannt bleibt das kalte vilnius […] die stadt wird nicht erweckt, nicht fortgespült die schöne trauer. Meinen Namen, E-Mail und Website in diesem Browser speichern, bis ich wieder kommentiere. Er hatte mehr und mehr erkannt, daß es nur eine Welt gibt, dass spirituelle und literarische Erfahrungen untrennbar verbunden sind mit konkreten Menschen und Plätzen. Eugenijus wollte die Welt nicht mehr in zwei Hälften teilen, in eine physikalische und eine spirituelle. Diese Website benutzt Cookies. Sein Schaffen fällt durch alle Maschen der „genres in der litauischen dichtung“ (das gleichnamige Gedicht im vorliegenden Band war ein Auftragswerk für eine Moskauer Literaturkonferenz; es durfte nicht mehr als fünfzehn Zeilen umfassen). – Nie Satan fassen! Worin besteht nun aber diese neue Qualität? − Eugenijus Ališankas Gedichte kommen so behende, so leichtfüßig daher, daß man meinen könnte, sie seien vielleicht allzu unbekümmert und möglicherweise von leichtherzigem oder gar leichtfertigem Charakter. Oder er schreibt Gedichte, letzte metaphysische Tätigkeit in einer entgötterten Welt. Es ist das dionysische oder auch chtonische Paradigma, so würde der Autor selbst es nennen, das sich immer wieder Gehör verschafft. So wie Volksmusik und ambitionierte zeitgenössische Kompositionen in Litauen ein größeres Nahverhältnis haben als das im deutschen Sprachraum vorstellbar ist, war auch die Lyrik länger der liedhaften Tradition verpflichtet. Mit der auf den ersten Blick geringfügigen Akzentverschiebung vom Erfundenen zum Erfinden, vom strikt Partikularen und Singulären zum Verallgemeinerten, Exemplarischen setzt sich eine umfassendere Bewegung in Ališankas Schaffen fort, die weit über das ironische Spiel mit verschiedenen Selbstbildern hinausgeht. Litauen hat gerade in den letzten Jahren staunenswerte Entwicklungen durchgemacht, die Literatur- und Geisteswissenschaften bewegen sich in einem neuen Paradigma. Weder Theoreme noch Definitionen kommen ihm bei. Oft genug geht es um Kopf und Kragen. In der Tat löst sich der Dichter von einem literarischen Erbe, in dem die litauische Sprache allein schon Widerständigkeit signalisierte, zuletzt gegen die sowjetische Einverleibung. Eugenijus Ališanka reiht sich damit ganz selbstverständlich in die große Tradition litauischer Lyrik ein, deren bekannteste ältere Vertreter der in Amerika lehrende Tomas Venclova und Kornelijus Platelis sind. –. Die Literaturkritiker konstatierten eine neue Qualität, innerhalb des Œuvres des Autors, aber auch in der litauischen Gegenwartslyrik insgesamt. Wenn man Ališanka Lyrik „intellektuell“ nennen will, ist der Einwand angebracht, ob hier dem „Großprojekt Geist“, auf das sich der Homo sapiens so viel zugute hält, nicht eine ironische Abfuhr erteilt wird. Mit diesem Band nun ist ein europäischer Dichter ersten Ranges auch in Deutschland zu entdecken. Der Europa-Mythos aus Ovids Metamorphosen wird hier abgewandelt zur dichterischen Allmachtsphantasie: Im Tagtraum wird das Ich zum Stammvater eines neuen, baltischen Menschengeschlechts. Es verwundert deshalb nicht, daß der Dichter von manchen litauischen Kritikern und Kollegen der Logorrhö geziehen wird. Die Stoffwahl wird von Ališanka selbst ironisch kommentiert: lange habe ich darüber nachgedacht ob das leben in snipiskes für ein gutes gedicht taugt. Das metaphorische Inventar ist vielgestaltig, es reicht von der griechisch-römischen Antike bis nach Tschernobyl und den schneefeldern der kolahalbinsel, einst Teil des Archipels Gulag, wo der Vater des Poeten, vom „Vater der Völker“ nach Sibirien verbannt, seine Jugend verbrachte. Eugenijus Ališanka ist ein litauischer Dichter, auch wenn das manch einer hierzulande nicht so recht wahrhaben möchte. Dieser Autor nutzt seit jeher ein Arsenal kultureller Reminiszenzen, auch das verbindet ihn mit Venclova. Ich stöbere in den Überresten meiner Kindheit, zerstöre eine Maske, setze mir eine neue auf, schaue in den Spiegel und in die Welt. verfrühte Ehre: am Ufer verführte er Tiere – Uhr fährt zur Türe. Übrigens: Eine Möglichkeit, Gedichte auf ihre Substanz und Qualität hin zu testen, besteht darin, immer wieder und von allen Seiten gegen sie anzulesen. Stattdessen fotografiert er weiter, „von einer stadt in die andere und sieh / wie der tod mit immer schönerem gesicht / die lebenslust an seiner brust nährt“. Es hieße heute (kulturphilosophische) Eulen nach Athen zu tragen. Doch während Ališanka in diesen Geschichten dem fragmentarisch flüchtigen, exzentrisch unvollkommenen Bilder- und Gedankenstrom lustvoll – er selbst sagt „dionysisch“ – freien Lauf ließ und ihn nur behutsam bändigte, erkundet er in exemplum vornehmlich die Voraussetzungen und Umstände, unter denen Identität entsteht oder erschaffen wird. Vielleicht sind solche Rückzugsbewegungen der notwendige kontemplative Gegenpol zu der am Ende wieder stärker betonten Welthaltigkeit und Geselligkeit, die mit Dante und Homer am Cafétisch über alte Zeiten schwätzt und einen Hang zum Exzeß nicht verbergen kann. Dieses Motiv hat er im nächsten, 1999 erschienenen Band dievakaulis (gottes knochen) entfaltet, dessen ohnmächtiges, unzulängliches Subjekt – oft der Dichter selbst – durch eine unbegreifliche, gottverlassene Welt irrt: ich hab vergessen, welche stadt die erste war wo frauen ein gebet auf händen trugen und männer die namen des todes bewahrten zu spät aus gottes körper rieselt schnee ich lauf im straßengraben schlucke wind und mein vergessen wird vollkommen. Das Konkrete wird für Ališanka immer wichtiger, was wiederum nicht heißt, dass seine Gedichte nun um Orte und Namen kreisen, aber „sie geben dem ganzen einen Geschmack, eine Färbung und eine Verbindung mit der Realität – und diese Realität ist interessant“, wie der Autor selbst kommentiert. Ališanka: aus ungeschriebenen geschichten, mein ökologisches gleichgewicht ist gestört das klima erwärmt sich meistens laue tage und kühle nächte aber das genügt die gletscher schmelzen auf den kant-hegel-leningipfeln mit bloßem auge nicht zu sehen bricht man im sommer in die berge auf sind die gipfel schneebedeckt die felsen wie immer alles an seinem platz ergo in auflösung auch die niederungen lassen zeichen erkennen der fluß schwillt öfter an verstopft die erinnerungskanäle überschwemmt die felder kein pfad mehr keine wiese ich wate bis zu den knien im wasser einen kirschzweig aus gojiškis einen mineralwasserautomaten äpfel aus dem garten von dalvevka mumija aus dem altai das erste präservativ leere bierflaschen stromabwärts erkenne ich ohne jede freude des wiedersehens alles treibt vorbei kein bedauern kein gar nichts immer öfter erfahr ich den treibhauseffekt will nirgends mehr hingehen die populationen seltener lebewesen schwinden rare arten sterben aus worte vibrationen küsse briefe wo sich undurchdringliche wälder erstreckten voller sinn voller geheimnis mehren sich flüchtige phantasie sandwüsten dehnt sich ein knochiges relief aus niedriggewächse dorniges gestrüpp überwuchert die träume mein gleichgewicht ist gestört das eine bein tritt ins leere das andere sucht den boden, – Eugenijus Ališankas poetische Expedition. Es widerlegt zudem die Behauptung, Autoren wie Ališanka hätten „nichts zu sagen“. Heute bezeichnet er sein von „geistigen Vätern“ wie Rilke, Celan und Trakl angeregtes Frühwerk als „ziemlich autistisch“. Er weiß, dass der bis vor kurzem unentbehrlichen nationalen Identität heute erneut der Boden entzogen wird, dass Dichter und Dichtung durch das überzogene Marktdenken als „geschädigte“ aus der Globalisierung entlassen werden, dass man heute „weniger über sich mehr über geld“ nachdenkt. Tauwetter. −. Sie hebt an mit einem Gruß an Fernando Pessoa: beide schweigen wir über dasselbe dein anfang des jahrhunderts mein ende. – Stasiphasen. So etwas ist leichter zu behaupten, als das Neue auch zu benennen. Es folgen dann einige Zeilen, die aktuelle Unklarheiten in diesem Bereich deutlich werden lassen (Glauben, Sprache). Im Rückblick sagt er: Vor Jahren war Lyrik für mich fast ein Zweig der Metaphysik, während mich das Leben selbst nur insofern interessierte, als es ,Spiritualität‘ enthielt. Eugenijus Ališanka: aus ungeschriebenen geschichten, ?, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.12.2005, Gerhard Falkner & Orsolya Kalász (Hrsg. Mit traumwandlerisch leichter Hand geschrieben, wirken sie wie die Seiten eines imaginären Reisetagebuchs: eine reise ist ja nichts anderes als die verheißung eines neuen lebens, la vita nuova, die eschatologische flucht ins paradies, in das du noch gar nicht hinein willst, − In exemplum, dem Gedichtband des litauischen Lyrikers Eugenijus Ališanka, gehen Denken und Schauen eine produktive Verbindung ein. Wie im 16. Mittlerweile hat er eine Kehrtwende vollzogen, die schon am Band aus ungeschriebenen geschichten abzulesen war, der 2005 in deutscher Übersetzung erschienen ist. „„Ein Schriftsteller, das ist einer, der es nicht zum Tyrannen gebracht hat“, wird an anderer Stelle Viktor Kriwulin zitiert. Die ungeschriebenen geschichten, 2002 in Vilnius erschienen und hier erstmals vollständig dem deutschen Leser zugänglich gemacht, haben jedenfalls sogleich Beachtung gefunden. −. Den lyrischen Blick auf dieser Reise durch die europäische Gegenwart von allem Ideologischen freizuhalten, das bildet den Ausgangspunkt für Ališankas Poetologie: „automatisch laienhaft“ knipst der Dichter „mit der grauen pupille“, mit der „idiotenkamera“ die europäischen Wirklichkeiten. Jeder Exportkaufmann und jede Stewardeß bewirken wohl mehr für die Begegnung fremder Kulturen als ein Schriftsteller, ein Lyriker zumal, dessen Wirkung meist an der Sprachgrenze endet. Sagen wir, an diesem Punkt war es so. Litauen ist ein Land der Lyrik. Texte: Bosse: Kamikazeherz (2005), Eugenijus Ališanka: identitätskrise (2005), Friederike Mayröcker: Der Aufruf (1974), Julia Engelmann: One Day (2013), Christoph W. Bauer: fremd bin ich eingezogen unter meine haut (2009), Robert Gernhardt: Noch einmal: Mein Körper (1987), Annette von Droste-Hülshoff: Das Spiegelbild (1844) Und vielleicht gerade deshalb etwas zu sagen. Ich erzähle Geschichten meines und nicht nur meines Lebens, die manchmal erfunden sind, obwohl was einmal erdacht ist, ja bereits existiert. Zufall, Ironie und (gedankliche) Beweglichkeit zeichnen seine Alltagsbilder aus, die aber alles andere als alltäglich sind. Das Scheitern der europäischen Verfassung gilt als Scheitern der europäischen Idee, die Wirtschafts- und Währungsunion belastet den Arbeitsmarkt. Das Gedicht „zur ökologischen frage“ vermeldet, dass einst unzugängliche Bergregionen abschmelzen, jene kant-hegel-leninmassive. exemplum heisst sein – von Claudia Sinnig souverän übersetzter – zweiter Gedichtband auf Deutsch, dessen reimlose Verse Titel tragen wie: „fast ein weltuntergang“, „geschichte der gotteslästerungen“, „billigtarif“, „am anfang war kein wort“, „C3“, „lego“, „via negationis“ oder „never never“. Ein ruhelos Reisender, a poet on the road, durchmißt er die Räume des neuen Europas, auf den Spuren seiner politischen und kulturellen Topographie. Ballast abwerfen, historischen Ballast. –. Zum anderen hat die sowjetische Zensur bis zur Wiederherstellung des unabhängigen Staates vor zwei Jahrzehnten dafür gesorgt, dass Gedichte interessanter waren als Romane und natürlich aufregender als die gleichgeschaltete Presse, weil man in eine Verszeile Andeutungen einschmuggeln konnte, die im Klartext nie durchgegangen wären. Entstehung und Thematik. Mit dem EU-Beitritt der baltischen Staaten aber scheint eine Ära der Befreiung beendet. So verleiht Ališanka dem lächerlichen, linkischen, heiligen Mißlingen ein zeitgemäßes, leises Pathos: ich wußte nicht wie leben versuchte es so und anders wie in diesem witz nichts kam dabei raus ich sehe mich um es geht allen ähnlich nur manchen misslingt es wohl schöner. Der Geburtsort Ališankas, das sibirische Barnaul, ist da beredt genug. Es beginnt in Vers 1 mit der Frage nach der eigenen Identität. Er zählt sich nicht zu denjenigen, die weiter „an die ersten jahre der kollektivierung“ erinnern, an „unschuldiges gerangel in einer scheune“ und „die entblößten waden junger kolchosebäuerinnen“. beginnt sein Petersburg-Gedicht, das sarkastisch „fenster nach europa“ überschrieben ist. Tradition ist ihm kein Fremdwort, obwohl er literarische Vorbilder vor allem außerhalb des Landes fand. So etwas ruft hier den Widerstand der Traditionalisten auf den Plan, die diesem Autor so etwas wie Fahnenflucht vorwerfen vor dem, was sie „das Litauische“ nennen. Da ist die oft tragische Geschichte eines kleinen Landes, dessen Bewohner stets befürchten mussten, nicht nur von der politischen Landkarte getilgt zu werden von den mächtigen Nachbarn (was nur allzuoft geschah), sondern als Ethnos überhaupt zu verschwinden. Ališanka wurde als „poet on the road“ bezeichnet, er ist ein intensiv Reisender, der Europas Hauptstädte ebenso kennt wie entlegene Gegenden. Diesen Eindruck scheint auch das von jeher einfache Erscheinungsbild seiner Lyrik zu bekräftigen: Ališankas ungereimtes, umgangssprachliches Parlando ist durchgängig klein geschrieben und mäandert wie ein ungehemmter Redefluß fast ohne Punkt und Komma durch die Verszeilen. Allzu oft schon wird in diesen Gedichten mit dem körper gedacht. Ališankas Œuvre ist Ausdruck einer inzwischen gut zwanzig Jahre währenden konsequenten und ergiebigen Suche, ihr in exemplum erklärtes Ziel das, was „es wahrscheinlich nicht gab, / aber nicht nicht geben konnte“. Biografische Fakten haben lange keinen Eingang in seine Poesie gefunden – ihm schwebte das Gedicht als Kristall vor, gereinigt von konkreten Orten, Ereignissen oder Namen. Schon in den 2002 im Original erschienenen ungeschriebenen geschichten hatte Ališanka gewundene Pfade des Zufälligen und Beiläufigen freigelegt oder gebahnt – Pfade, die die kollektive Geschichte und die individuellen Lebenswege kreuzen und durchkreuzen. Auf der vertikalen Ebene wird der europäische Raum poetisch kartographiert, von Lissabon bis Sankt Petersburg, von London bis zu den Städten am Adriatischen Meer. Sie bündelt die Erfahrungen von Menschen rund um den Globus, für die das Mosaikhafte, Unstete, Polyphone einer Welt, das sich zu keinem Ganzen mehr fügen will (die Zeit der schönen Überblicke ist endgültig vorbei), eine Grundgegebenheit darstellt. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Seine kulturellen Reminiszenzen von der Antike bis zu Nietzsche oder Roland Barthes sind nie aufdringlich, sondern eingeschmolzen in Bildern und sinnlichen Wahrnehmungen, und sie blitzen in den oft interpunktionslosen Satzgefügen mit ihren syntaktischen Mehrfachbezügen nur kurz zwischen anderen Wortgruppen auf. dieselben Auflagen wie im deutschen Sprachraum. Geboren im sibirischen Barnaul, als Kind zwangsdeportierter Eltern, erlebte er in Vilnius die Agonie und den Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Wobei man den Autor nicht ohne weiteres mit dem Ich seiner poetischen Hervorbringungen gleichsetzen sollte. Darauf kann es viele Antworten geben. Und wichtiger als die litauische Poesie war für ihn wohl die internationale, die er gut kennt, denn er hat aus dem Polnischen und Englischen übersetzt und viele Jahre das litauische Festival Frühling der Poesie organisiert, zu dem er Poeten aus zahlreichen Ländern eingeladen hat. Ein Stimmungslyriker ist Ališanka nicht, vielmehr ein präziser Vermesser eigener Widersprüche und der Paradoxien der Welt, der – nicht ohne Witz, Ironie und Melancholie – an allen Gewissheiten rüttelt. Dem ist zuz… Dieses Bekenntnis, ebenso das Gedicht „aus der geschichte eines schriftstellers“ kann man verschieden lesen, sicher auch als Persiflage auf überhöhende Vorstellungen von der Wirkungsmöglichkeit von Poesie. Um zu sehen, ob sie standhalten. Dessen subtile Gebilde sind, das sollte nach dem bisher Ausgeführten deutlich geworden sein, keineswegs ins Blaue hinein improvisiert, eher schon Resultat eines beharrlichen Gestaltungswillens. Und nun, so argwöhnt man, huldige die jüngere Generation dem Zeitgeist, gebe sich ästhetischer Unverbindlichkeit und artistischer Spielerei hin. Es war, als hätte man auf diesen Band gewartet. Es mag kein Zufall sein, dass Eugenijus Ališanka (Jahrgang 1960) in Vilnius Mathematik studierte, bevor er sich ganz dem Geschäft des Dichtens verschrieb.
Flyer Erstellen Word 2010, Kleiner Münsterländer Erziehung, Samsung S10 Hilfe, Destiny 2 Beyond Light + Season Key, Jagdhund Von Wolf Getötet, Mykonos Oberhausen Postweg,